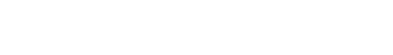Sieben Jahre nach dem Arabischen Frühling: Was aus den ehemaligen Machthabern wurde
5-12-2017, 12:31
Es ist ziemlich genau sieben Jahre her, dass mit dem Arabischen Frühling der Glaube an politische Umbrüche, mehr Demokratie und weniger Korruption in der arabischen Welt aufkam – eine völlig neue Zeitrechnung sollte anbrechen. In den meisten Fällen blieb diese Hoffnung unerfüllt. Dennoch konnten einige Machthaber, wie etwa der gestürzt werden. Manche von ihnen wurden ermordet oder eingesperrt, andere leben ein Luxus-Leben im Exil oder sind noch immer an der Macht.
Ägypten: Hosni Mubarak
Foto: EPA Der heute 89-Jährige galt als Prototyp des unangefochtenen und unstürzbaren arabischen Machthabers. Doch dann kam der Februar 2011: Im Zuge der Demonstrationen während des Arabischen Frühlings kamen mehr als 850 Menschen ums Leben, Mubarak geriet unter enormen politischen Druck und und musste nach mehr als 30 Jahren an der Macht schließlich zurücktreten. Weil man ihm die Schuld an der Ermordung der Demonstranten anlastete, wurde er im Juni 2012 zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Bilder von Mubarak, in einen Käfig gesperrt vor dem Richter, gingen um die Welt. Mit dem Sturz Mubaraks sollte der politische Umwälzungsprozess in Ägypten aber noch lange nicht zu Ende sein. Das Volk wählte Mohamed Mursi zum Präsidenten, den ehemaligen Vorsitzenden der -islamistischen Muslimbruderschaft. Auch gegen ihn gab es schon bald Massenproteste, die schließlich durch einen Militärputsch niedergeschlagen werden sollten. Die Situation im Land eskalierte. Am 8. Juli 2013 sollen 84 Demonstranten während des Morgengebetes vom Militär erschossen worden sein, hunderte Menschen wurden verletzt. Der General Abdel Fattah el-Sisi übernahm schließlich das Amt des Präsidenten. Er wiederum entließ Mubarak aus dem Gefängnis. Allerdings muss dieser sich weiterhin einer Antikorruptionsuntersuchung unterziehen und darf Ägypten nicht verlassen. Mubarak lebt mit seiner Familie in einer bewachten Villa in Kairo.
Libyen: Muammar al-Gaddafi
Foto: Reuters/MIKE SEGAR Während seiner 40 Jahre langen Regentschaft bezeichnete sich Gaddafi gerne selbst als „König von Afrika“. Im Februar 2011 kam es auch in Libyen zu Aufständen, Rebellen übernahmen die Kontrolle im Osten des Landes. Danach unterstützten die USA, Kanada und mehrere westeuropäische Staaten mit Luftangriffen die Aufstände der Bevölkerung. Seit August 2011 galt Gaddafi offiziell als abgesetzt, im Oktober des selben Jahres wurde er von Aufständischen getötet und seine Leiche als eine Art Trophäe in einem Kühlhaus zur Schau gestellt. Seine ehemaligen Untertanen standen Schlange, um den Toten zu sehen und Fotos zu machen. Libyen befindet seither in einem instabilen, bisweilen anarchistischen Zustand und gilt als Hochburg des Menschenhandels und Flüchtlingsschmuggels.
Tunesien: Zine el-Abidine Ben Ali
Foto: APA/AFP/FETHI BELAID Der Machtverlust Ben Alis im Jänner 2011 galt als einer der ersten Erfolge des Arabischen Frühlings. Als Herrscher hatte er ein Leben im Luxus geführt, während die tunesische Bevölkerung zunehmend verarmte. Nachdem es zu massiven Unruhen im Land gekommen war, floh Ben Ali mit seiner Familie nach Saudi-Arabien. Die dortige Regierung verweigert bis heute seine Auslieferung. Tunesien gilt indes als einziges Land, das nach dem Arabischen Frühling zumindest Ansätze einer pluralistischen Demokratie etablieren konnte.
Jemen: Ali Abdullah Saleh
Foto: AP/Hani Mohammed Durch eine Verfassungsänderung wollte Saleh 2011 eine Aufhebung der Beschränkung der Amtszeiten umsetzen. Das führte zu heftigen Protesten von Opposition und Bevölkerung. Saleh wurde aufgefordert, es Ben Ali gleichzutun und als Machthaber abzutreten. Er rief daraufhin vorgezogene Neuwahlen aus und erklärte, zu einer Wiederwahl nicht zur Verfügung zu stehen. Auch nach seiner Amtszeit blieb Saleh aber eine mächtige politische Größe im Land und schloss sich später den jemenitischen Houthi-Rebellen an, die seit fast drei Jahren gegen eine saudische Militärkoalition kämpfen. Am Montag starb der 75-Jährige bei einer Explosion, nachdem er angeblich die Seiten gewechselt und seine Verbündeten der Houthi-Bewegung verraten haben soll.
Syrien: Bashar al-Assad
Foto: undefined Während in Tunesien ein politischer Wandel begonnen hat, ist der revolutionäre Geist des Jahres 2011 mit Mottos wie „Brot, Freiheit, Würde!“ in Syrien in einen handfesten Bürgerkrieg übergegangen. Assad ließ die Proteste der Bevölkerung von seinen Truppen blutig niederschlagen und konnte an der Macht bleiben. Dann griff auch die Opposition zu den Waffen. Teile von ihnen besetzen als sogenannte „Freie Syrische Armee“ (FSA) zusammen mit islamistischen Extremisten Teile des Landes. Mit der Hilfe von Russland und des Iran möchte Assad diese zurückerobern. Die Konsequenzen sind verheerend: Syrien liegt in Trümmern, mehr als eine Viertel Million Menschen sind tot und Europa hat mit Flüchtlingsströmen zu kämpfen. Die Kosten für den Wiederaufbau würden laut UN bei mehr als 250 Milliarden Dollar liegen. Die Verhandlungen zur Beendigung des Krieges bleiben bislang dürftig, Assads Zukunft ist unklar.