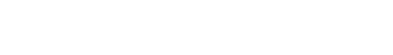Analyse zum Wahlkampf: Über die Macht des Volkes
15-10-2017, 06:00
Lange hat der Wahlkampf gedauert, allzu lange. Er hatte ja schon begonnen, als die Regierung noch so tat, als würde sie regieren, in beiden Parteien aber ständig auf Umfragen geschielt und in der ÖVP schon über den Sturz des Parteichefs beraten wurde. Und dann wurde in den vergangenen Monaten so getan, als würde die nächste Bundesregierung, also die nationale Politik eines kleinen Landes, große Entscheidungen weit über unsere Grenzen hinaus fällen können. Und das mit viel Aufwand und noch mehr Emotionen.
Machtverlust
Dabei verhält sich die Aufgeregtheit der Politik verkehrt proportional zu ihrer schwindenden Bedeutung in der globalisierten Welt – Konzerne haben oft mehr Einfluss als nationale Regierungen. Abhängigkeit von der Ökonomie gab es aber früher auch, aber eben auch den Primat der nationalen Politik.
So war die Währungsreform 1947 Bedingung für die Teilnahme am Marshall-Plan, gleichzeitig aber ein politisches Statement, dass sich das besetzte Österreich zum Westen bekannte. Auf den Ölschock im Jahr 1973 wurde mit nationalen Maßnahmen reagiert, die das Bewusstsein der Abhängigkeit von Rohstoffen stärkte. Die Bindung des Schilling an die Deutsche Mark und die Hartwährungspolitik hat die Regierung Kreisky in den 1970er-Jahren bewusst gewählt, die Exportwirtschaft gefordert, aber durch höhere Wettbewerbsfähigkeit letztlich gefördert. Die verstaatlichte Industrie war die längste Zeit Spielball der Politik im schlechtesten Sinn, aber auch Ausdruck der Macht von Politikern oder Parteien. Noch 1987 hat die Regierung die Staatsindustrie mit viel Geld gestützt, erst dann kam es zu Privatisierungen.
Das waren alles bewusste, zum Teil vorbereitete Entscheidungen von Regierungen, die – und das ist das Wichtigste – transparent und irgendwie begründbar waren. Politik war verständlich, überschaubar, nachvollziehbar. Die Macht war im Kanzleramt. Natürlich spielten auch Persönlichkeiten mit Emotionen – niemand konnte das besser als Bruno Kreisky. Dazu kam ein fast stetig wachsender Wohlstand. Die Politik vermittelte Berechenbarkeit und dadurch Sicherheit, national wie international.
Davon ist nur wenig geblieben. So gefährlich der Kalte Krieg in manchen Phasen war, Mauerbau, Kuba-Krise, Raketenrüstung in Mitteleuropa, so klar waren die Fronten. Und den Österreichern war immer klar, auf welcher Seite sie standen.
Der schwarz-rote Proporz war leistungsfeindlich und ungerecht, aber er bot den einen Orientierung und den anderen die Chance zur persönlichen Harlekinade – nicht wenige waren mal bei der einen, mal bei der anderen Partei. Der Herr Karl lebt.
Neue Medienmacht
Der Wille zum Aufstieg verband ehemalige Klassenfeinde. Arbeiterfamilien konnten ihre Kinder ebenso auf höhere Schulen schicken wie kleine Gewerbetreibende und Bauern. Ein Haus bauen oder Fernreisen machen war für breite Schichten der Bevölkerung möglich. Und das relativ knapp nach dem Krieg, das hat der Gesellschaft Zusammenhalt, Sicherheit und Selbstbewusstsein gegeben.
Dann ist ab der Jahrtausendwende in kurzer Zeit viel zusammengekommen: Wirtschaftskrise, Digitalisierung, offene Grenzen, Globalisierung. Überall im Westen regierten Parteien, die verwöhnt vom Erfolg ihrer alten Rezepte nur diesen vertrauten. Oder die, wie Tony Blair und Gerhard Schröder, nicht mehr an die Sozialdemokratie glaubten und ihr die Seele nahmen. Andere propagierten den Rückzug in kleine Einheiten, emotional verständlich, aber auch keine Lösung.
Digitale Medien brauchen keine Ideen, sondern Figuren, die Clicks bringen, ein Messias wird gerne genommen, aber auch Bösewichte. Dazu kommt, dass durch die digitalen Plattformen sogenannte Echokammern erzeugt werden: Jeder bekommt Nachrichten, die seine Meinung noch verstärken.
In der großen Verwirrung lassen die Künstler fast völlig aus, diejenigen , die sich Intellektuelle nennen, scheuen Debatten. Angst, Anpassung oder Ahnungslosigkeit? Oder finden sie sich auch nicht mehr zurecht?
"Die Macht geht vom Volk aus, heißt es in unserer Verfassung. Aber welche Macht, wenn ein kleines EU-Land im Kreise der anderen Kompromisse suchen muss? Wir haben durch den Beitritt zur EU bewusst auf ein Stück Souveränität verzichtet, aber uns mehr Einfluss verschafft, weil wir in Brüssel mitreden, während die Schweizer EU-Richtlinien nachvollziehen. Wir sollten die Mitarbeit in der EU als Teil unserer nationalen Politik verstehen. Souveränität haben wir auch verloren, wenn US-Konzerne unser Leben mehr beeinflussen als unsere Regierung, wenn Daten gesammelt werden, die auch unsere Behörden nicht kontrollieren können.
Politiker reden nicht gerne über ihre Machtlosigkeit, im Wahlkampf schon gar nicht. Aber Vertrauen kann nur zurückkommen, wenn geklärt ist, wo noch nationale Entscheidungen möglich sind und wenn die Strukturen der Macht verstanden werden.
Machtmissbrauch
Viel nationale Freiheit gibt es bei den Steuern. SPÖ und ÖVP, die in den letzten Jahrzehnten stets die Steuern erhöht haben, versprechen eine Senkung. Aber unsere paternalistische Politik verteilt gerne, dieses Stück Macht genießen Politiker auf allen Ebenen des Staates. Wo wirklich gespart werden soll, haben wir nur rudimentär erfahren.
Und keine äußere Macht hindert unsere Regierung, endlich für ein Bildungssystem zu sorgen, wo alle Kinder gefordert und gefördert werden, je nach ihren Begabungen. Und sich die Parteien endlich aus den Schulen schleichen. Pardon.
Das Volk ist nicht machtlos, die Regierung auch nicht, aber sie muss Zuständigkeiten aufzeigen, gerade, sollte es zu mehr Referenden kommen. Nicht alles eignet sich dafür, und Information müsste verfügbar sein. Und die Politiker sollten endlich aufhören, Medien dominieren oder kaufen zu wollen.